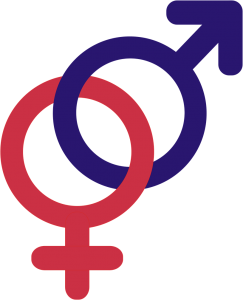 Frauen und Männer sind sich ziemlich ähnlich, zumindest was die Herzratenvariabilität angeht. In jungen Jahren ticken ihre Herzen noch verschiedenen, dann passen sie sich mit zunehmendem Alter aneinander an. Trotz des kleinen Unterschieds sollte das Geschlecht immer in die Interpretation einer Messung einbezogen werden.
Frauen und Männer sind sich ziemlich ähnlich, zumindest was die Herzratenvariabilität angeht. In jungen Jahren ticken ihre Herzen noch verschiedenen, dann passen sie sich mit zunehmendem Alter aneinander an. Trotz des kleinen Unterschieds sollte das Geschlecht immer in die Interpretation einer Messung einbezogen werden.
Die wissenschaftlichen Standards zur Messung und Auswertung der Herzratenvariabilität (HRV) lieferte 1996 eine Expertenkommission aus Amerika und Europa. Von der Task Force European Society of Cardiology und der North American Society of Pacing Electrophysiology wurden einige Richtwerte zur Orientierung veröffentlicht. Zum Thema Geschlechtsunterschiede finden sich allerdings keine Referenzwerte.
Die Empfehlungen der Task-Force ungeachtet sind sich viele Experten 20 Jahre später einig, dass das Geschlecht bei den Messergebnissen eine Rolle spielt. Die Unterschiede bei Männlein und Weiblein fangen beim Hormonhaushalt an und enden beim Körperbau. Sowohl das Hormone als auch die Herzfrequenz nehmen Einfluss auf die HRV – fraglich ist aber, ob es signifikant geschlechterspezifisch ist. So einfach sich die Geschlechtsunterschiede darstellen lassen, umso komplizierter und unklarer ist die Studienlage. Bei dem Thema Geschlechtsunterschiede driften die Meinungen teilweise weit auseinander (Beispiel: Umetani et al. versus Ramaeckers et al.). Um mich nicht in den Widersprüchen der Wissenschaft zu verfangen, orientiere ich mich bei meinem Beitrag an den Ausführungen der Herren Wittling (siehe Buch Herzschlagvariabilität) und an Doris Eller-Berndl (Herzratenvariabilität, Verlagshaus der Ärzte)
Mehr Gesamtpower bei den Männern
Die gesamte Aktivität des vegetativen Nervensystems ist in der Männerwelt wohl von Natur aus besser ausgeprägt als in der Damenwelt. Einige Studien belegen diesen Unterschied mit Parametern wie beispielsweise der Root-Mean-Square-of-Successive-Differences (RMSSD), der Standard-Deviation-of-the-NN-Intervall (SDANN) oder auch der Total-Power. Die größten Differenzen zwischen Frauen und Männer finden sich bei den Werten der Gesamtaktivität in der Altersklasse der 20 bis 30jährigen. Mit zunehmendem Alter kommt es immer mehr zu einer Angleichung der Geschlechter. Ab dem fünften Lebensjahrzehnt sind die Unterschiede quasi aufgehoben. Eine gute Übersicht, wie sich die Werte über die Jahre verändern, findet sich in der kostenfrei verfügbaren Studie von Umetani et al. (1998).
Junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren scheinen beim Abschalten einen Vorteil gegenüber ihren Altersgenossinnen zu haben. Der Einfluss ihres Parasympathikus ist stärker, dass zeigt sich bei den höheren Werten im High-Frequency-Bereich (HF). In Langzeitmessungen konnte beobachtet werden, dass sich Frauen vor allem in den Abend- und Nachstunden schlechter entspannen konnten als Männer. Vielleicht eine Einrichtung der Natur, die jungen Müttern einen Vorteil bei der Obhut ihres Nachwuchses verschaffen möchte.
Mit zunehmendem Alter kommt es zu einer Angleichung
Mit den Jahren kommt es zu einer Angleichung. Die etwas höhere Pulsfrequenz der jungen Damen gleicht sich an die männliche an. Die Unterschiede bei der Entspannungs- und Erholungsfähigkeit heben sich zwischen den Geschlechtern mit zunehmendem Alter ganz auf – vorausgesetzt, es finden keine Hormontherapien oder ähnliches statt.
Ein ähnlicher Befund findet sich zum Einfluss des Sympathikus. Die Werte der Low-Frequency-Bereich (LF) sind bei Männern zwischen 20 und 50 Jahren höher als bei Frauen. Auch bei diesem Wert kommt es im höheren Lebensalter zu einer Angleichung.
Das Verhältnis von Sympathikus und Parasympathikus bzw. LF und HF unterliegt auch dem Alter und Geschlecht. Bei der sympathovagalen Balance (LF/HF) dreht das Verhältnis. In jungen Jahren, zwischen 20 und 30, sind die Unterschiede zwischen den Frauen und Männern noch geringer ausgeprägt, als im fortgeschrittenen Alter (50 bis 60 Jahre).
Zusammenfassend halte ich folgende grobe Regel im Normalfall für vertretbar:
Frauen unter 30 Jahren haben eine schlechtere HRV als Männer. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden ab dem 30. Lebensjahr geringer und verschwinden nach dem 50. Lebensjahr ganz.
